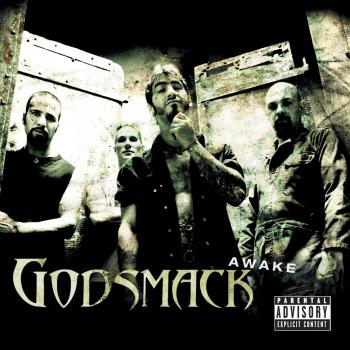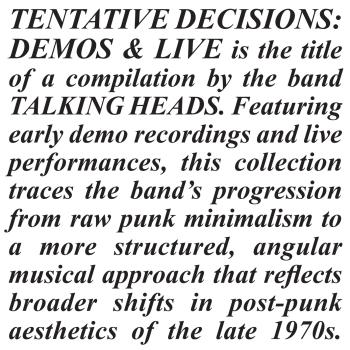What Do You Mean? Max Hacker with Roland Schneider & Lars Gühlcke
Album info
Album-Release:
2016
HRA-Release:
16.08.2016
Album including Album cover
- 1 Conclusion 07:07
- 2 What Do You Mean? 05:49
- 3 After Te Rain 05:33
- 4 Le Coucou 04:36
- 5 Equinox 04:59
- 6 Dear Lord 06:50
- 7 That's Another Story 05:00
- 8 Touching Sky 04:14
- 9 Fifth House 06:12
Info for What Do You Mean?
Mit meisterhaftem Understatement präsentiert sich der Berliner Saxofonist Max Hacker auf „What do you mean?“. Hackers Musik strahlt Grandezza aus, ganz ohne Effekthascherei und frei von Plattitüden. Es ist genau das meisterlich Solide in Hackers Spielweise, das Unbestechliche, das den Reiz dieses Albums ausmacht. Die Sprache des Modern Jazz hat Hacker aufgesogen seit er fünfzehn war – bei Reisen in die USA und schließlich beim Studium an der New Yorker New School of Music. Und diese Jazz-Sozialisation in den USA ist unüberhörbar gelungen: Er spielt auf US-Muttersprachler Niveau‘. Genauso unüberhörbar aber ist Hackers derzeitige Verortung im Berlin. Die Mischung macht Max Hacker einmalig: Er spielt ebenso formvollendet wie ausdrucksfroh.
„What do you mean?“ ist nach „Who The Heck is Max Hacker“ und „Deconstructing“ bereits Hackers dritte Einspielung unter eigenem Namen. Hacker selbst aber hat sich als versierter Mitspieler schon auf vielen Einspielungen bewährt – diesseits und jenseits des großen Teichs. Dabei hat er sich einen klaren Standpunkt geschaffen. Hacker macht sich nicht gemein mit schnellflüchtigen Trends aus den Jazz-Metropolen New York oder Berlin. Es ist sein kultivierter Ton, durch und durch von echter Jazz-Schönheit getragen, der Max Hacker so besonders macht, und es ist seine innovative Spielweise, die über die gängige modale Auffassung hinausgeht.
Auch Hackers Kompositionen strahlen große Klarheit und damit Schönheit aus. So leitet er bei „Conclusion“ mit samtigem
Ton das Thema ein, um es als Amalgam der zweierlei Auffassungen fortzuführen, zu steigern, an Lars Gühlcke am Bass und Roland Schneider am Schlagzeug abzugeben und am Ende wieder als Quintessenz zusammenzufassen. Dabei setzt das Trio geschickt kontrastierende Akzente, etwa zur säuselnd sanften Melodie einen zischelnden Triolen-Gang am Schlagzeug. Das Trio dieser Einspielung ist ohnehin ein Glücksfall. Es ist schließlich auch das auf hörbar großem Vertrauen und Wertschätzung gegründete Zusammenspiel der Band, das diese Album auszeichnet. Besonders eingängig ist das in „What Do You Mean?“zu spüren, nämlich im sich umschmeichelnden innigen Spiel von Lars Gühlckes Bass und Max Hackers Saxofon.
Dass Hacker neben Eigenkompositionen Werke von John Coltrane spielt, überrascht kaum. Überraschend ist seine Lesart: so frisch und doch so fein, auf eine sehr ergreifende Weise die Tradition goutierend, münzt Hacker die Originalkompositionen nach seiner Auffassung um, immer lupenrein im Klang und im Umgang mit der Tonalität. Hackers interpretatorischer Umgang mit dem Ausgangsmaterial mag an die ergiebigen und wendigen Harmonie-Erkundungen in der Lennie Tristano Nachfolge erinnern und ist doch anders und neu. Genau diese ungewöhnliche Eloquenz ist die Errungenschaft von Hackers Album „What do you mean?“.
„Durchweg ist die Intensität des Interplays beeindruckend, und gerade die Coltrane-Stücke gewinnen durch das fehlende Akkordinstrument an Klarheit, Präsenz und einer Chuzpe, die geradezu von den rauen Straßen Berlins zu stammen scheint.“ (Jazzthing)
Max Hacker, Tenor & Sopransaxophon, Bassklarinette, Altflöte
Lars Gühlcke, Bass
Roland Schneider, Schlagzeug
Max Hacker
Die Anfänge: Zu meiner Kindheit – insofern sie relevant für meine Musik ist – kann ich nur sagen, daß ich nicht in einem musikalischen, wohl aber in einem kreativen Haushalt aufgewachsen bin.
Mit zu meinen ersten Kindheitserinnerungen zählen Szenen, in denen meine Eltern - beides bildende Künstler - in unserer mit Bildern und Kunstgegenständen vollgerümpelten Wohnung, leidenschaftliche Diskussionen mit ihren Freunden über die Kunst im Allgemeinen und Speziellen abhielten. Der Ladenraum unsrer Westberliner Erdgeschoßwohnung war die Galerie meines Vaters; hier trieb ich mich herum und beobachtete die Ausstellungen und deren Besucher. Die pausenlose Beschäftigung aller meiner Bezugspersonen mit den Themen Kunst und Kreativität nahm ich als selbstverständlich hin.
Mit etwa sieben Jahren begann mein Interesse an der Musik. Zweimal in der Woche besuchte ich einen musikalischen Früherziehungskurs; diesem angeschlossen war ein Chor, in den ich nach zwei Jahren eintreten durfte. Hier sangen wir Werke der Frührenaissance und Gregorianische Choräle.
Da meine Eltern mich stets in meinen kreativen Interessen unterstützten, waren sie auch einverstanden, als ich ihnen eröffnete, Altsaxophon lernen zu wollen. Nun war meine Schule leider keine besonders musikalisch orientierte, so dass ich, abgesehen von sehr sporadischem und eher unqualifiziertem Unterricht, mir mit meinem Instrument selbst überlassen war. Allerdings hatten meine Eltern mich von der Vorschule an in eine Deutsch-Amerikanische Gemeinschaftsschule geschickt, so dass die Sprache und Kultur der USA (damals hatte das zugegebenermaßen noch einen positiveren Beigeschmack) mir immer näher kamen.
Mit vierzehn, fünfzehn Jahren entdeckte ich so langsam den Jazz für mich, und die beiden Faktoren Saxophon und USA verdichteten sich immer mehr zu der Vorstellung, nach dem Abitur nach New York City gehen, und dort Jazz zu studieren. Diesem einen Ziel fieberte ich die nächsten Jahre entgegen, nichts würde mich davon abbringen.
Endlich angekommen: Es war wirklich einer der größten Momente meines bisherigen Lebens, als ich mit neunzehn Jahren am New Yorker J.F.K. Flughafen mit meinen Koffern, meinen Instrumenten und einer beträchtlichen Bargeldsumme aus dem Flugzeug stieg. Ich fühlte mich so frei und war so voller Tatendrang, dass ich fast den geheiligten Boden küsste (das muss man sich heute mal auf der Zunge zergehen lassen...)
Ich bezog ein kleines Zimmer - es sollte nur der Anfang einer langen Reihe kleiner, teurer Zimmer sein - und erkundete die Stadt. Es war inspirierend, nur durch die Straßen zu wandeln, und alles zu beobachten. Genau wie das Leben dort so vielfältig war, war auch die Musikszene.
War ich nach einem genialen Konzert eines Bebop Quartetts überzeugt, dies sei die Musik, der ich mein Leben widmen muss, so konnte ich am nächsten Tag schon leidenschaftlicher Verfechter der Downtown Freejazz Szene sein. Auch meine Lehrer wechselte ich öfter als manche Kollegen ihre Unterwäsche. Billy Harper verschrieb mir ein hartes Intervall-Regiment, und kommentierte mein Spiel nicht im geringsten. Harold Danko, der mich am Piano begleitete, machte mich mit den verschiedenen Bebop Skalen bekannt. Er war der Überzeugung, ich sei absolut auf dem richtigen Weg, und solle genau so weitermachen. Am Nachmittag dann schrie Hal Galper mir ins Gesicht, ich sei eine Null, mir fehle auch nur das rudimentärste an Möglichkeiten. Dies mag übertrieben wirken, aber das mir ausgesprochene Lob und Tadel klaffte bisweilen extrem auseinander.
Mit der Zeit lernte ich vor allem, gut zu beobachten, nicht alles wörtlich zu nehmen, und mir von jedem etwas abzuschauen. Ich glaube, ich habe in dieser Zeit viel von Mitschülern gelernt. Von welchen, die bereits Probleme gelöst hatten, die mir gerade bevorstanden, und von welchen, die sogar noch weniger wussten als ich. Die New School, die Universität, an der ich studierte, ermöglichte dies durch das Konzept des ständigen Musizierens. In fast jeder Klasse mußte ich mein Instrument auspacken, und den Lehrern, die die jeweiligen Klassen unterrichteten, wurde freie Hand gelassen, diese nach ihren eigenen Vorstellungen abzuhalten. Das bedeutete Ensembleunterricht bei Jim Hall, wo alle immer so leise spielten, dass man jederzeit die Kommentare von Jim hören konnte. Richie Beirachs Unterricht konzentrierte sich allein auf motivische Entwicklung. Lobte Reggie Workman in seiner Klasse eigenwilliges Improvisieren, so ließ Buster Williams einem nichts, was auch nur einen Anschein von "Bullshit!" sein konnte, durchgehen.
Ich könnte noch länger so fortfahren; letztendlich blieb die Erkenntnis, dass viele Wege zum Ziel führen, und jeder sich in der Tat seinen eigenen suchen muss. So vergingen die Jahre, und langsam wurde mir klar, daß es nicht leicht sein würde in New York sein Brot als Jazzmusiker zu verdienen. Auch war mir bei meinen regelmäßigen Berlinbesuchen aufgefallen, wie enorm sich Berlin in diesen Jahren `92 bis `97 entwickelte. So interessant es war, in New York immer und immer wieder neue Musiker kennenzulernen, die wie Götter spielten, so interessant schienen mir aber auch die Möglichkeiten, die Berlin mittlerweile bot.
Zurück auf 'Los‘: Also fand ich mich im April `97 am Flughafen Tegel wieder; die Instrumentenkoffer waren mehr, das Geld deutlich weniger geworden. Aber wie sich bald herausstellte, bot diese Stadt einem neu angekommenen Musiker durchaus die Möglichkeit, sich über Wasser zu halten. Die Szene, die ich früher immer als irgendwie klein und von Vetternwirtschaft geprägt empfunden hatte, war in meinen Augen eine dynamische, dem neuen aufgeschlossene Szene geworden. Ich habe immer noch den Eindruck, dass von Jahr zu Jahr das musikalische Niveau deutlich steigt. Die Stadt profitiert von den vielen guten Musikern, die sich hierher gezogen fühlen, meine ich. In dieser Hinsicht halte ich persönlich die Konkurrenz (aus Mangel an einem positiver besetzten Begriff) für etwas sehr gutes und befruchtendes.
Obwohl ich zu dem Zeitpunkt meiner Rückkehr schon mit vielen Musikern gespielt und viele Konzerte und Sessions bestritten hatte, fühlte ich mich ein weiteres Mal musikalisch und persönlich vor einem Neuanfang. Mein Gefühl, in erster Linie Schüler zu sein, verflüchtigte sich zunehmend innerhalb der ersten Jahre nach meiner Rückkehr. Nach wie vor faszinierten mich verschiedene Spielarten des Jazz; auf der anderen Seite kristallisierte sich immer mehr "etwas eigenes" heraus. Anfangs waren es vor allem die Experimente am Sound (Mundstücke, Blätter und alles andere worüber sich Saxophonisten stundenlang unterhalten können), die ich einstellte - irgendwie hatte ich langsam aber sicher einen Sound gefunden. Auch die Zweifel darüber, wie viele und welche Stilistiken ich spielen dürfte, um ja nicht inkonsequent zu klingen, gab ich auf als ich merkte, dass alles, was man mit einer starken, eigenen Persönlichkeit spielt konsequent klingt. Natürlich lagen und liegen auf diesem Weg noch viele Meilen vor mir, lediglich über die ersten Schritte in diese - meine eigene - Richtung war ich froh, als ich sie bemerkte.
This album contains no booklet.